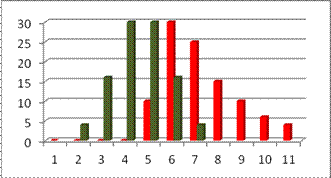
4 Referenzintervalle
Laborwerte werden wie klinische Befunde erst dann als auffällig gewertet, wenn sie außerhalb eines als physiologisch oder „normal“ angesehenen Intervalls liegen. Die Festlegung eines solchen Referenzintervalls ist keine triviale Angelegenheit. Sie erfordert unter anderem die Definition von „Gesundheit“ als Voraussetzung der Einbeziehung eines Individuums in die Gruppe der Probanden, aus deren Werte das Referenzintervall konstruiert wird. Die International Federation of Clinical Chemists empfiehlt eine Mindestanzahl von 120 Probanden. Die Frage der Repräsentativität betrifft nicht den Umfang der Stichprobe der Probanden, sondern den Auswahlmodus. Eine Stichprobe ist dann repräsentativ, wenn jedes MItglied der Zielgruppe die gleiche Chance hatte, ausgewählt zu werden.
Zunächst muss entschieden werden, ob nur Erhöhung oder nur Erniedrigung eines Wertes oder auch beides krankhaften Charakter hat. Im letzten Fall, und wenn die Verteilung der Werte hinreichend genau einer GAUSS-Verteilung entspricht, was keineswegs immer der Fall ist, wird ein Referenzintervall oft aus arithmetischem Mittel ± 2 Standardabweichungen errechnet. Dies bewirkt, dass an beiden Enden der Verteilung jeweils ca. 2,5 % der Population „abgeschnitten“ werden, ihre Werte mithin als auffällig kategorisiert werden, obwohl alle Werte von „gesunden“ Individuen stammten. Ist die Voraussetzung der GAUSS-Verteilung nicht erfüllt, können die Grenzen des Referenzintervalls unterhalb der 2,5 % höchsten und oberhab der 2,5 % niedrigsten Werte gezogen werden. Wenn allein Erhöhung von klinischem Interesse ist (wie zum Beispiel bei der Aktivität der meisten plasmaunspezifischen Enzyme), ist es meines Erachtens wenig sinnvoll, von einem Referenzintervall zu sprechen, denn eine Untergrenze ist nicht von klinischer Relevanz und wird auch nicht angegeben.
Neben dieser mehr statistischen Methode gibt es noch andere Methoden, Referenzintervalle festzulegen, von denen noch eine erwähnt werden soll, weil sie besonders den Belangen der klinischen Medizin als handlungsorientierter Disziplin entgegenkommen. In der Humanmedizin wird beim Blutdruck eine Grenze dort gesetzt, ab der es für die Betroffenen von Nutzen ist, Antihypertensiva einzusetzen. In der Nutztiermedizin wäre eine Grenze da zu ziehen, von wo ab eine Intervention wirtschaftlich ist. Diese Konzepte mögen theoretisch sehr einleuchtend klingen; ihre praktische Umsetzung ist aber alles andere als trivial.
Eine Reihe von Faktoren kann die Ausprägung von Laborparametern beeinflussen, so zum Beispiel Rasse, Geschlecht, Alter, Trächtigkeit, Laktationsstadium, Tageszeit, Intervall seit der letzten Futteraufnahme. Referenzintervalle sind offensichtlich umso schmäler, je mehr dieser Faktoren standardisiert werden, was letztlich auch etwas mit der verfolgten Fragestellung zu tun hat. Aus der Fragestellung ergibt sich auch die Wahl der Referenzpopulation. Beispiel: Wenn mögliche Einflüsse auf die D-Laktat-Konzentration im Plasma/Serum von präruminierenden DFV-Kälbern untersucht werden sollen, wird man als Referenzpopulation nicht alte DSB-Kühe auswählen. Außerdem kann auch die Wahl des Referenzintervalls von der Fragestellung und der relativen Bedeutung falsch positiver und falsch negativer Beurteilungen abhängen (siehe "Sensitivität" und "Spezifität" im Kapitel "Testtheorie" im Skript über Klinische Epidemiologie). Die meisten der in Lehrbüchern angegebenen Referenzinzervalle scheinen nach dem Motto "One size fits all" erstellt zu sein.
Der Vergleich eines an einem Patienten ermittelten Wertes mit einem aus den Werten "gesunder" Individuen erstellten Referenzintervall gestattet nur die Beurteilung als unauffällig oder auffällig, wobei letzerer Fall als Indikation für weitere Untersuchungen angesehen werden kann. Genauer wäre die Angabe des Anteils der als unauffällig angesehenen Individuen, bei dem Werte in mindestens dieser Größe gemessen wurden. Direkte Hinweise auf ganz bestimmte Krankheiten geben Laborwerte selten, so sehr das die praktische Diagnostik vereinfachen würde. In den meisten Fällen gibt es vielmehr eine mehr oder weniger breite Überlappung der Werte von Patienten mit dem Referenzintervall. Die Verteilungskurve von Patientenwerten ist nicht symmetrisch, sondern auf der Seite pathologischer Werte weit ausgezogen.
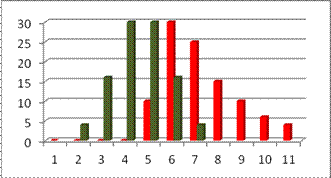
Abb.1: Schematische Darstellung der Verteilungskurven für einen fiktiven Laborparameter bei der Referenzpopulation (grün) und bei Patienten mit einer bestimmten Krankheit (rot). Die Abszisse zeigt fiktive Werte des Parameters, die Ordinate den Anteil (%) der Population. Illustriert werden solle die Überlappung der Wertebereiche und die Asymmetrie der Verteilungskuve der Patientenwerte.
Sofern nicht anders angegeben, beziehen sich die Referenzintervalle auf Rinder und stammen zumeist aus dem Labor der Klinik für Wiederkäuer der LMU München.
Letzte Änderung:13.10. 2015