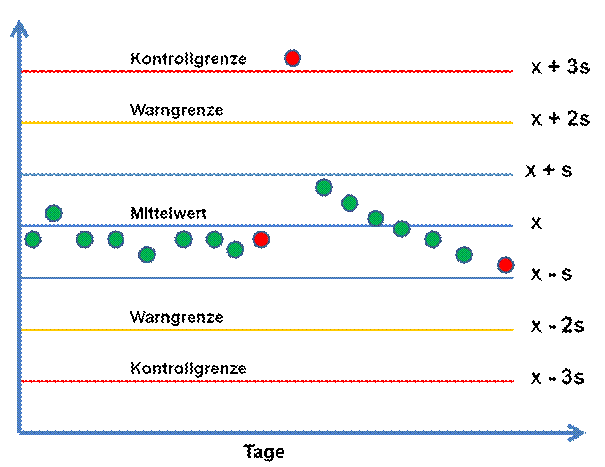
18 Qualitätssicherung im klinischen Labor
Die Methoden der Qualitätssicherung im klinischen Labor sind den entsprechenden Methoden bei der Kontrolle der industriellen Fertigung entlehnt. Man kann interne und externe Qualitätskontrolle unterscheiden. Interne Qualitätskontrolle: Zwei zentrale Begriffe sind Präzision (oder vielmehr Unpräzision) und Richtigkeit. Die Unpräzision ist ein Maß für die Streuung der Ergebnisse mehrerer Messungen an derselben Probe. Sie wird meist angegeben als Variationskoeffizient (Standardabweichung als Prozentsatz des arithmetischen Mittelwertes) und ist Folge zufälliger Fehler. Die Unpräzision ist am geringsten bei Messungen in der Serie (gleicher Untersucher, gleiches Gerät) und am größten bei Messungen durch verschiedene Laboratorien (Unpräzision in der Serie, von Tag zu Tag, von Untersucher zu Untersucher, von Labor zu Labor). In der praktischen Labordiagnostik wird die Unpräzision von Tag zu Tag meist anhand eines eigenen Standards (zum Beispiel Mischserum) überprüft, von dem zunächst in einer Vorperiode von 20 Tagen täglich eine kleine Probe aufgetaut und analysiert wird.
Mittelwert, doppelte (Warngrenzen) und dreifache (Kontrollgrenzen) Standardabweichungen werden als parallele Linien in ein Formblatt eingetragen, bei dem die Abszisse aus einem Monat besteht. Täglich wird zusätzlich zu den Patientenproben eine weitere Probe des Standards gemessen und das Ergebnis mit Hilfe eines Klebepunktes in das Formblatt eingetragen. Die Methode gilt als außer Kontrolle, wenn ein Messwert außerhalb des Kontrollbereichs (Mittelwert plus/minus dreifache Standardabweichung) liegt, wenn sieben Messwerte in Folge auf derselben Seite der Mittelwertlinie liegen, oder wenn sieben Werte in Folge entweder ansteigen oder absteigen.
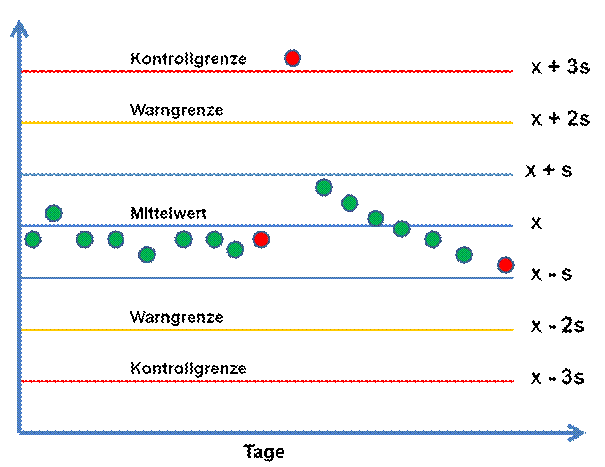
Abb. 18.1: Schema der internen Qualitätskontrolle (auf Präzision)
Richtigkeit bezeichnet die Übereinstimmung des gemessenen Wertes mit dem wahren Wert. „Unrichtigkeit“ ist die Folge systematischer Fehler (Beispiel: falsches Filter am Fotometer). Im Gegensatz zur Präzision kann Richtigkeit kann nur durch Untersuchung von Proben mit bekanntem Wert überprüft werden. Solche Kontrollserien sind im Fachhandel erhältlich. Behelfsweise kann die Richtigkeit auch durch Messung einer Probe vor und nach Aufstockung durch eine Lösung bekannter Konzentration bestimmt werden. (Beispiel: In einer Serumprobe wird eine Harnstoffkonzentration von 5 mmol/L gemessen. Nun werden zu 10 mL dieses Serums 2 mL einer Harnstofflösung mit 50 mmol/L zugegeben. Als „richtiger Wert“ in der Mischung ist 12,5 [(5*10 + 2*50)/12] µmol/mL = mmol/L zu erwarten.
Das Konzept von Präzision und Richtigkeit lässt sich anschaulich mit Hilfe des Zielscheibenmodells nach Büttner und Stamm illustrieren:
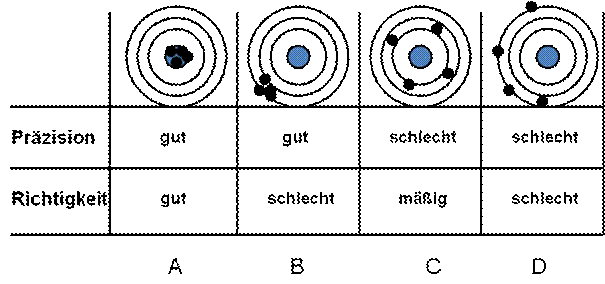
Abb. 18.2: Schießscheibenmodell nach BÜTTNER und STAMM zur Illustration von Präzision und Richtigkeit
Im Fall A sind Präzision und Richtigkeit optimal. Im Fall B ist die Präzision optimal, die Richtigkeit aber offensichtlich schlecht. Bei C ist die Richtigkeit (als Mittelwert der Messungen) akzeptabel, die Präzision aber miserabel. Im Fall D sind beide Größen nicht akzeptabel.
Externe Qualitätskontrolle: Teilnahme an Ringversuchen, bei denen Proben untersucht werden, für welche vorher von einem Referenzlabor die entsprechenden Werte gemessen worden sind. Die Werte werden jedoch erst nach Eingang der Untersuchungsergebnisse aller teilnehmenden Labors bekanntgegeben und ausgewertet.