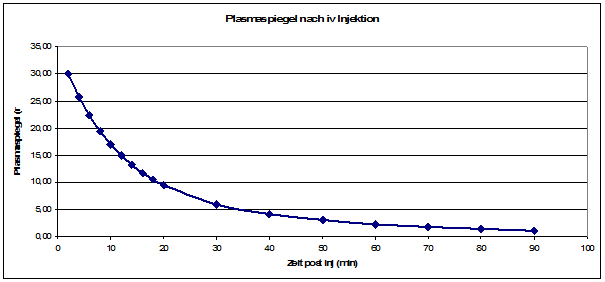
11.2 Nierenfunktionsproben
Physiologie und Pathophysiologie
Indikationen zur Bestimmung
Bestimmungsmethoden
Referenzbereich
Interpretation von Abweichungen
11.2.1 Effektiver renaler Plasmafluss
Da nicht die gesamte Perfusion der Niere an glomerulärer Filtration und/oder tubulärer Sekretion teilnimmt, wird mitunter der so genannte effektive renale Plasmafluss bestimmt. In der klinischen Praxis hat die Messung aber kaum Bedeutung erlangt. Sie wird hier aus didaktischen Gründen beschrieben. PAH (Paraaminohippurat) wird bei niedrigem Plasmaspiegel so gut wie völlig aus dem Blut entfernt, zum Teil durch glomeruläre Filtration und zum Teil durch tubuläre Sekretion. Die renale Clearance dieser Substanz wird daher als Maß für den effektiven (d.h., an der Elimination beteiligten) Plasmafluss gewertet. Das Verhältnis von Inulin-Clearance zur PAH-Clearance wird als Filtrationsfraktion bezeichnet, da Inulin nur durch glomeruläre Filtration eliminiert wird (s.u.).
11.2.2 Glomeruläre Filtrationsrate
11.2.2.1 Inulin-Clearance
Inulin ist ein natürliches verzweigtes Polyfruktose-Molekül, das im Säugerorganismus nicht verstoffwechselt wird und renal nur durch glomeruläre Filtration ausgeschieden wird. Seine über Bolus-Injektion und nachfolgende Dauerinfusion (zur Herstellung eines konstanten Blutspiegels) und quantitative Harnsammlung ermittelte Clearance diente lange Zeit als Goldstandard der GFR-Bestimmung. Es ist offensichtlich, dass diese Methodik sich nicht für die klinische Routine eignet.
Klinisch relevanter sind vereinfachte Methoden (Single-shot-Clearance mit Zwei-Kompartiment-Analyse oder Totalclearance). Zwar werden auch sie in der Buiatrik nicht routinemäßig eingesetzt, sollen aber wegen ihrer grundsätzlichen Bedeutung für das Verständnis auch der Grundlagen der Pharmakodynamik hier kurz besprochen werden.
Nach der zügigen intravenösen einer Substanz fällt der Blutspiegel zunächst sehr rasch (was als Folge der Verteilung interpretiert wird) und danach langsamer (was als Folge der Elimination interpretiert wird).
In der folgenden Grafik ist das beispielhaft dargestellt.
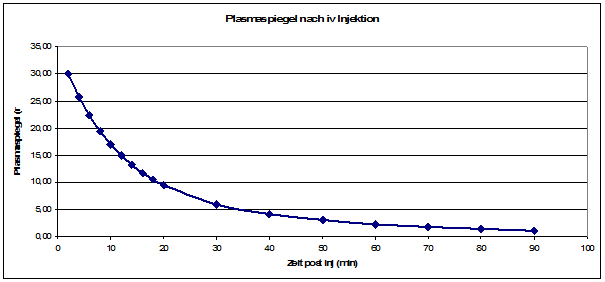
Bei halblogarithmischer Darstellung (Logarithmus der Konzentration) ergibt sich folgendes Bild
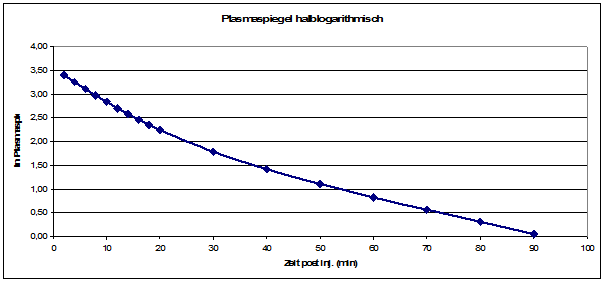
Es zeigt sich, dass die Kurve ab etwa 50 min post inj. sich einer Gerade annähert.
Das bedeutet, dass der Abfall des Blutspiegels nunmehr einfach logarithmisch ist, also pro Zeiteinheit ein konstanter Anteil der jeweils vorhandenen Substanzmasse eliminiert wird, also eine konstante Halbwertszeit besteht. Ihre Berechnung erfordert zunächst die Ermittlung der Gleichung der Geraden. Die Blutspiegel an zwei zeitlich genau bestimmten Punkten haben die Koordinaten x1;y1 und x2;y2
Dann gilt nach der allgemeinen Geradengleichung
(y - y1)/(x - x1) = (y2 - y1)/(x2 - x1)
Beispiel:
Bei einer Kuh mit 650 kg KM werden 5000 mg BSP i.v. injiziert.
Nach 50 Minuten (x1) und nach 90 Minuten (x2) werden Blutproben entnommen, und der BSP-Plasmaspiegel bestimmt.
50 min (x1) 3,03 mg/L; ln 7,2 = 1,11 (y1)
90 min (x2) 1,06 mg/L; ln 1,7 = 0,06 (y2)
(y - 1,11)/(x - 50) = (0,06 - 1,11)/(90 - 50)
(y - 1,11)/(x - 50) = - 0,144
y - 1,97= - 0,144x + 1,44
y = - 0,144 x + 3,41
Das entspricht der üblichen Form der Geradengleichung
y = mx + b
Dabei ist m die Steigung der Geraden (hier mit - 0,144 negativ, weil die Werte stets fallen) und b (hier) 3,41 ist das absolute Glied, das den Schnittpunkt der Gerade mit der Ordinate angibt. e3,41 = 30,3 mg/L wäre die theoretische Anfangskonzentration, die sich ergeben hätte, wenn sich die injizierte Substanz schlagartig und gleichmäßig in dem Raum verteilt hätte, dessen “Entleerung“ sich im Abfall der Plasmakonzentration widerspiegelt.
Die Halbwertszeit berechnet sich nach der Formel
HWZ = ln2/m = 0,693/0,144 = 4,8 min
Für die mathematisch ganz Unerschrockenen sei hier kurz die Herleitung dieser Gleichung angegeben:
Ein einfach logarithmischer Abfall hat die Formel
y(t) = e-kt
Dabei ist y(t) der Wert zum Zeitpunkt t und k eine Konstante, die beispielsweise in der Radiophysik die Zerfallskonstante darstellt. Im halblogarithmischen Raster entspricht sie der Geradensteigung.
Geht man von einer initialen Konzentration von 1 aus, dann wird die Konzentration ½ nach Verstreichen einer Halbwertszeit erreicht. Dann gilt:
½ = = e-kt
Durch Logarithmieren erhält man
ln½ = -kt
ln½ = ln1 – ln2
ln 1 = 0
Daraus folgt:
-ln2 = -kt
t = ln2/k
11.2.2.2 Kreatinin-Clearance (s. 7.5.1)
11.2.3 Konzentrationsleistung
In der klinischen Praxis wird die Konzentrationsleistung der Nieren meist anhand der Harndichte gemessen. Es gibt verschiedene Methoden, die Harndichte zu bestimmen. Direkt ist das über die Verwendung einer Senkspindel (Aräometer) möglich. Rein theoretisch wäre es auch über die Wägung eines definierten Volumens Harn möglich. Es werden aber meist Refraktometer verwendet, mit denen der so genannte Refraktionsindex gemessen wird, also der Winkel, um den das Licht bei der Passage durch Lösungen abgelenkt wird. Der Refraktionsindex wird nur durch die Konzentration der gelösten Teilchen beeinflusst, die Dichte aber auch durch deren Masse. Da aber der relative Anteil der verschiedenen im Harn gelösten Substanzen recht konstant ist, besteht eine enge Korrelation zwischen Refraktionsindex und Dichte.
Die Dimension der Dichte hängt von der Bestimmungsmethode ab. Üblicherweise wird sie wie folgt angegeben 1020, wobei die korrekte Dimension mg/mL wäre, aber nicht genannt wird.
Im Gegensatz zu den Verhältnissen bei meisten klinisch-chemischen Parametern gibt es bei der Harndichte einen natürlichen Anhaltspunkt zur Beurteilung. Der Bereich 1008 bis 1010 entspricht einer Harnosmolalität, die derjenigen des Plasmas gleicht. Harndichte deutlich darüber bedeutet daher, dass der Körper gegenüber der GFR Wasser einspart, Werte darunter bedeuten, dass der Körper zusätzlich Wasser eliminiert. Letzteres ist bei Kälbern, deren Nahrung rein flüssiger Natur ist, der Fall. Ihre physiologische Harndichte ist also niedriger als der angegebene Bereich.
In manchen Publikationen wird behauptet, Kälber könnten ihren Harn nicht im gleichen Maße wie erwachsene Rinder konzentrieren. Das ist nicht richtig, denn der als Maximalkonzentration bei Rindern (und Menschen) angegebene Wert der Harnosmolalität von ca. 1400 mosmol/kg (der einer mehr als vierfachen Konzentration gegenüber der Plasmaosmolalität entspricht) wurde auch bei Kälbern nachgewiesen.
Referenzbereich:
1020 – 1040 bei ruminierenden Rindern
< 1012 bei Saugkälbern
12.2.4 Tubuläre Rückresorptionkapazität
12.2.4.1 Glukose (s.
Glukose wird glomerulär filtriert und tubulär so gut wie vollständig rückresorbiert. Diese Rückresorption ist ein aktiver, Energie verbrauchender Prozess, der ein Maximum hat. Erscheint Glukose im Endharn, ist also die tubuläre Rückresorptionskapazität („Nierenschwelle“) überschritten. In diesem Fall ist zu prüfen, ob der Blutglukosespiegel deutlich über den normalen Bereich erhöht ist oder war (z.B. nach Glukoseinfusion, Injektion von Glukokortikoiden, bei Stress oder Diabetes mellitus) oder ob er eher erniedrigt ist.
12.2.4.2 Eliminationsfraktion von Natrium (EFNa) (s. 8.1.1)